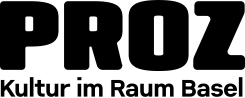PROZ, Februar 2025, S. 28/29
Iris Kretzschmar
Das Kunstmuseum Basel stellt für einmal in den Vordergrund, was sich hinten auf den Gemälden befindet.
Was sich nicht alles auf Rückseiten entdecken lässt! Die Ausstellung «Verso» Im Kunstmuseum Basel gibt Einblick in einen Bereich, der fürs Publikum noch nie zu sehen war: In speziell gefertigten Rahmen und auf Sockeln kann man 36 Kunstwerke sowohl von vorne als auch von hinten begutachten. Alles Sammlungsstücke, die aus dem 14. bis 18. Jahrhundert datieren.
Die Rückseiten zeigen nicht nur Botschaften aus alten Zeiten, verschiedene Etiketten und Inschriften, sie sind auch häufig mit Bildern geschmückt, die Aufschluss über die Geschichte der jeweiligen Schauseite geben. Darunter befinden sich gemalte Wappen, Ornamente, Schriften oder Trompe-l’Œil-Malereien von gefaktem Marmor. Tatsachen, die Zeugnis ablegen über die Auftraggebenden und den Produktionskontext. Oft sind es wichtige Hinweise für das Kurations- und Restaurationsteam respektive Auktionshäuser, die teilweise eine regelrechte Detektivarbeit leisten, um den Indizien auf die Spur zu kommen und den Zusammenhang der Bildtafeln zu rekonstruieren.
Wandelaltäre und Andachtstafeln
Den Auftakt machen zwei vollständig erhaltene Flügelaltäre aus dem 16. Jahrhundert. Diese besondere Form eines Altaraufsatzes besteht aus einem statischen Schrein und beweglichen Flügeln, die im Laufe des Kirchenjahres auf- und zugeklappt wurden. Die von ihrer liturgischen Funktion her meistens doppelseitig geschmückten Retabel geben auf verschiedenen Schauseiten Auskunft über das Patrozinium und den Entstehungskontext. Ganze Heiligengeschichten sind auf den Aussen- und Innenseiten der Flügel angeordnet, während der Mittelteil für das hochrangige Personal, Christus und Maria, reserviert ist. Man darf dabei nicht vergessen, dass sich diese sakralen Objekte an ein Publikum richteten, das zum grossen Teil aus Analphabeten bestand, aber die Bilder zu lesen verstand. Wohlhabende, gläubige Familien bezahlten und eroberten sich so einen Platz im sakralen Bilderreigen. Durch die Sponsorentätigkeit erhoffte man sich eine gute Beziehung zum Klerus und das Seelenheil im Jenseits abzusichern.
Nachträgliche Umgestaltung und Inschriften
Der Fall, dass eine Rückseite später von anderer Hand umgestaltet wurde, findet sich bei einem Diptychon von Hans Holbein dem Jüngeren. Das bedeutende Doppelbildnis des Basler Bürgermeisters, Jacob Meyer zum Hasen und seiner Frau Dorothea Kannengiesser (1516), wurde nachträglich von unbekannter Hand mit Meyers Wappen auf 1520 datiert. Eine kleine Krimimalgeschichte verbirgt sich gar hinter dem Porträt eines nobel gekleideten Edelmannes. Wie sich herausgestellt hat, war er mit seiner Familie unter einem Decknamen 1544 nach Basel gezogen und hatte eine ganze Schar von Angehörigen der Täuferbewegung mitgebracht. Obwohl er als führende Persönlichkeit der Sekte gesucht wurde, konnte David Joris unbemerkt bis zu seinem Tode 1556 seinen Glauben leben. Postum kam die wahre Identität ans Licht und er wurde nachträglich als «Erzketzer» verurteilt, seine Leiche exhumiert und verbrannt. Ein Text in Latein und Deutsch auf der Bildrückseite berichtet von den dramatischen Ereignissen.
«Verso. Geschichten von Rückseiten»: Sa 1.2.25 bis So 4.1.26, Kunstmuseum Basel, www.kunstmuseumbasel.ch